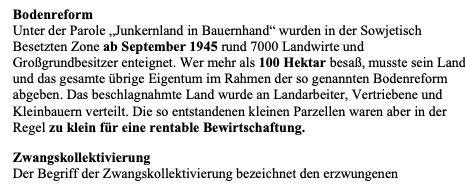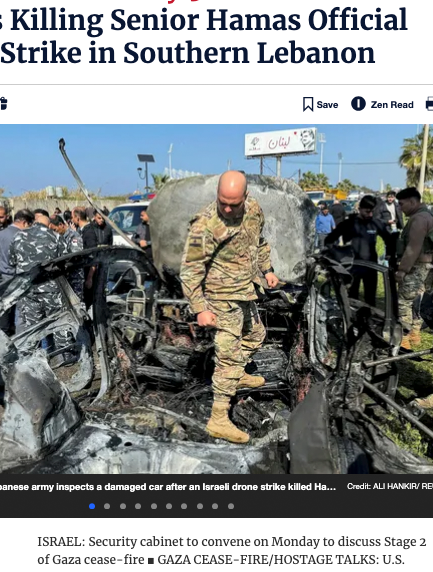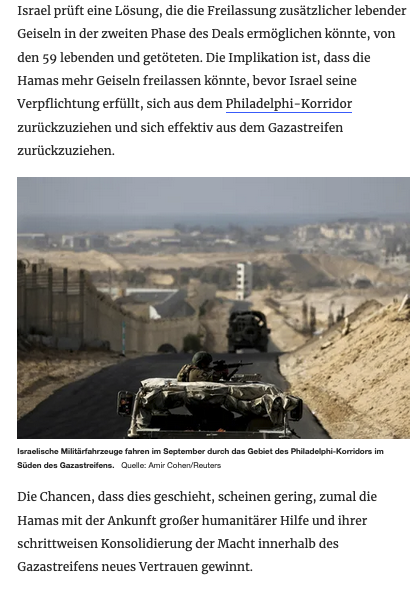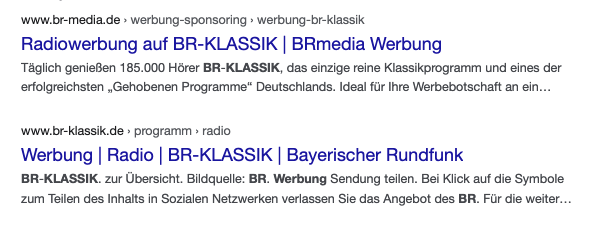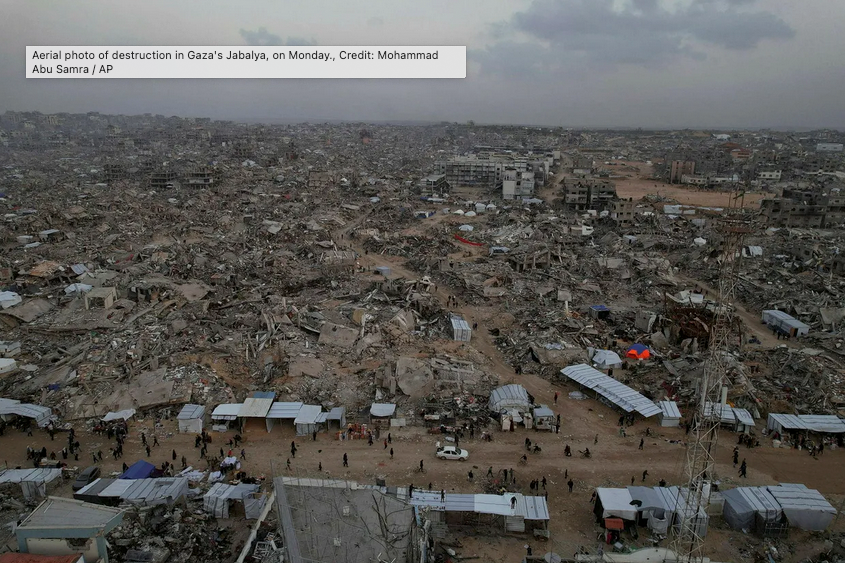ORF/Christian Öser
Berlin
Spiegelbild der deutschen Wohnungsnot
Hohe Mieten und Wohnungsknappheit sind in Deutschland ein akutes Problem, auch wenn es vor der Bundestagswahl am Sonntag von der Migrationsdebatte in den Schatten gestellt wird. Die Parteien schlagen sehr unterschiedliche Maßnahmen gegen die Misere vor. Eine Entspannung der Lage zeichnet sich nicht ab, große Ankündigungen der Politik sind verpufft. ORF.at hat mit Fachleuten gesprochen und war in Berlin unterwegs.
Online seit gestern, 6.05 Uhr
„Wohnungen sind knapp – und wenn etwas knapp ist, wird’s teuer“, bringt Matthias Günther, Leiter des Pestel-Instituts, das Problem gegenüber ORF.at auf den Punkt. „Der Wohnungsbau wurde über viele Jahre vernachlässigt“, Forderungen nach 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr habe das Forschungsinstitut mit Sitz in Hannover schon vor vielen Jahren erhoben, die Politik habe aber nicht reagiert.
„Mit der Bevölkerungsentwicklung kam das einfach nicht mit“, so Günther. Die Nachfrage sei nicht zuletzt aufgrund des Zuzugs stark gestiegen. Der Bedarf ist also hoch, das Angebot sehr gering. Derzeit würden in Deutschland 290.000 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt, sagt Franz Michel, Leiter für Wohnungs- und Mietenpolitik beim Deutschen Mieterbund, gegenüber ORF.at. ORF/Christian Öser In Berlin werden derzeit vielerorts Wohnungen gebaut – die Nachfrage ist aber weit höher als das Angebot
Ziel klar verfehlt
Das von der aktuellen Regierung ausgegebene Ziel, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu errichten, wurde also krachend verfehlt – obwohl mit dem Antritt der „Ampelkoalition“ aus SPD, Grünen und FDP im Dezember 2021 sogar das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen geschaffen wurde, das von Ministerin Klara Geywitz (SPD) geführt wird.
TV-Hinweis
ORF2 zeigt morgen um 20.15 Uhr eine ZIB Wissen zur Bundestagswahl.
Neben Berlin ist die Lage auch in den anderen Großstädten schwierig – zunehmend betroffen sind auch Mittel- und Kleinstädte. „Die Metropolen strahlen weit über ihre Grenzen hinaus aus“, sagt Günther. Zur Wohnungsknappheit kommt, dass die Mieten immer weiter ansteigen. Neben dem knappen Neubau gibt es dafür einen weiteren Grund – es gibt immer weniger öffentliche Wohnungsakteure und Sozialwohnungen.
Fotostrecke mit 12 Bildern
ORF/Christian Öser Der Edge East Side Tower, in Berlin besser bekannt als „Amazon Tower“, weil der gleichnamige Konzern dort seinen Sitz hat. Zur Eröffnung des bis dato höchsten Gebäudes der Stadt gab es Proteste – zum einen gegen Amazon, zum anderen gegen die fortschreitende Gentrifizierung des Gebiets um die Warschauer Straße. ORF/Christian Öser Gut 360.000 landeseigene Wohnungen gibt es in Berlin. Verwaltet und vermietet werden sie von sechs Gesellschaften: Degewo, Gesobau, Gewobag, Howoge, Stadt und Land sowie WBM. Ihr Eigentümer und Gesellschafter ist das Land Berlin. Im Bild: Wohnhäuser im neu errichteten Wohnbauprojekt „Friedenauer Höhe“: 238 Wohnungen gibt es hier – verwaltet von der Howoge. Alle Wohnungen werden als Sozialwohnungen vermietet. ORF/Christian Öser Der Sitz der Deutsche Wohnen SE in Berlin – hierbei handelt es sich um eine börsennotierte Wohnungsgesellschaft. Das Unternehmen besitzt nach eigenen Angaben 140.000 Wohnungen, davon gut 100.000 in Berlin. Seit 2021 gehört die Deutsche Wohnen mehrheitlich zu Vonovia. Beide Unternehmen bilden Europas größtes Wohnungsunternehmen. Die kommerziellen Interessen sorgten in der Vergangenheit für viel Kritik – etwa seitens der Bürgerinitiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“. ORF/Christian Öser Die Bürgerinitiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ wirft Immobilienkonzernen in Berlin große Profite durch steigende Mieten vor. Ziel der Initiative ist die Vergesellschaftung der Berliner Wohnungsbestände von Großvermietern mit über 3.000 Wohnungen in Berlin. Dabei sollen die enteigneten Wohnungen in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt werden. Das beträfe etwa 243.000 der rund 1,5 Mio. Mietwohnungen in Berlin. Beim Volksentscheid 2021 befürworteten mehr als eine Million Berliner das Anliegen. ORF/Christian Öser Im laufenden Wahlkampf spielt das Thema Wohnen eine Rolle – wenn auch in den Schatten gestellt vom großen Thema Migration. Linke und Grüne affichieren das Wohnthema, die SPD tat das ja im vorigen Bundestagswahlkampf, konnte aber die Ankündigungen nicht umsetzen. ORF/Christian Öser Das Areal des ehemaligen Berliner Flughafens Tempelhof: Das Areal hat eine Fläche von rund 300 Hektar. Für Berlinerinnen und Berliner dient die riesige unbebaute Fläche als relativ zentral gelegenes Naherholungsgebiet. Eine Bebauung war lange tabu – doch an diesem rüttelte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Ende 2024 im Bundestag, als er sich für Wohnungsbau auf dem Tempelhofer Feld ausspra ORF/Christian Öser Kanzler Scholz argumentierte im Bundestag, Deutschland müsse „in riesigem Umfang neue Wohnungen bauen“. Man müsse sich deshalb trauen, etwa den ehemaligen Flughafen zu bebauen, „der da gewissermaßen ungenutzt rumliegt“, wie Scholz sagte. Doch liegt die Entscheidungskompetenz nicht beim Bund, dieser hätte also nicht zu entscheiden. Eine Bebauung des Tempelhofer Felds wurde vor zehn Jahren mit einem Volksentscheid verboten und ist derzeit nicht möglich. ORF/Christian Öser Eine der bekanntesten Perspektiven auf den Fernsehturm – der Blick von der Warschauer Brücke Richtung Nordwest. Die Kräne sind für die Errichtung des Gewerbeprojekts „Wriezener Karree“ im Einsatz. Auf dem 14.000 Quadratmeter großen Areal wird ein Gebäudeensemble mit gemischter Nutzung entstehen, allerdings ohne Wohnu ORF/Christian Öser Für den Bau neuer Abschnitte der durch Berlin führenden A100 mussten auch Wohnungen weichen – dieser Abschnitt soll nach Verzögerungen nun heuer eröffnet werden. Gegen das Projekt gab es viel Widerstand, etwa vom „Aktionsbündnis A100 stoppen“. Doch wird Abschnitt für Abschnitt eröffnet. ORF/Christian Öser In Berlin wie auch in vielen anderen Städten wird vielfach nachverdichtet: Der Begriff bezeichnet im Städtebau das Nutzen freier Flächen im Bereich bereits bestehender Bebauung. Hier wird ein ehemaliger Parkplatz bebaut. ORF/Christian Öser Berlin entspricht in der Fläche etwa Wien, Graz und Linz zusammen und hat etwa 3,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Die Nachfrage nach freien Mietwohnungen übersteigt das Angebot um ein Vielfaches. So sind Massenbesichtigungen für ein Objekt keine Seltenheit. Wohnraum ist knapp, die Mieten steigen sukzessive. ORF/Christian Öser Eines der größten Bauvorhaben in Berlin ist das Projekt "GoWest“ auf dem Gelände einer ehemaligen Zigarettenfabrik. Für mehr als eine Milliarde Euro sollen etwa 10.000 Arbeitsplätze entstehen. Wohnungen sind auf dem Areal nicht geplant, denn die Fläche ist für die reine Gewerbenutzung ausgewiesen.
Bild 1 von 12
„Bezahlbarer Wohnraum wurde privatisiert“
In Berlin etwa seien „massenhaft ehemalige Sozialwohnungen oder Wohnungsbaugesellschaften an private Wohnungskonzerne wie Vonovia oder Deutsche Wohnen veräußert worden, die natürlich eine ganz andere Strategie verfolgen“, so Michel. „Bezahlbarer Wohnraum ist im Prinzip privatisiert worden.“
Um eine Regulierung zu schaffen, initiierte die Regierung – noch unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) – die Mietpreisbremse, sie wurde 2015 in Kraft gesetzt. Dadurch sollte verhindert werden, dass Mieten bei Neuvermietungen übermäßig steigen können. Sie gilt in 415 Gemeinden in dreizehn von sechzehn Bundesländern. Sie gibt bei Neuanmietung vor, dass die Miete höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf.
ORF/Christian Öser Angesichts der dramatischen Schieflage halten Fachleute die politischen Konzepte allesamt für ungenügend
„Mietpreisbremse hat nie gebremst“
Doch ist das Instrument wirksam? „Die Mietpreisbremse hat nie gebremst“, sagt Günther von Pestel-Institut – allein schon durch das hohe Preisniveau. Sie entfalte keine nachhaltige Wirkung, weil zahlreiche Ausnahmen sie untergraben. Mieter und Mieterinnen müssten selbst aktiv werden und überhöhte Mieten anfechten – ein Schritt, den viele aus Angst und Unsicherheit vermeiden, heißt es vom Mieterbund.
Doch ist die Bremse auch nicht in der Lage, bezahlbaren Wohnraum zu erhalten: Weil etwa in Berlin früher Mieten sehr günstig waren, führe das bei Neuvermietung zu starken Erhöhungen. „Wenn in Berlin eine Wohnung frei wird, die pro Quadratmeter 5,50 Euro gekostet hat, dann darf der Vermieter bei Neuvermietung laut der Bremse auf zehn Prozent über der ortsüblichen Miete erhöhen. Wenn die jetzt bei neun Euro liegt, darf für die Wohnung 9,90 pro Quadratmeter verlangt werden“, so Günther.
Fotostrecke mit 12 Bildern
ORF/Christian Öser Die noch eingerüsteten Zwillingstürme „Max und Moritz“ prägen die Skyline Berlins: Im Turm „Max“ soll es Wohnungen, Büros, Geschäfte, Gastronomie, Dachgärten und einen Pool geben. „Moritz“ – knapp hundert Meter hoch – wird Wohnungen und Gewerbe bieten und gehört dann damit zu den größten Wohnhäusern Berlins. Der Bau war ins Stocken geraten. Nun soll es aber weitergehen. ORF/Christian Öser Die Weiße Siedlung ist eine typische Großsiedlung, die in den 1970er Jahren im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus entstanden ist. Die Sozialbindung ist 2016 ausgelaufen. Dahinter in Bau: der Estrel-Tower. Er wird bis Ende 2025 gebaut, doch schon jetzt hat er die 150-Meter-Marke erreicht und ist damit das höchste Hochhaus der Stadt. ORF/Christian Öser Bis 2021 war in Berlin der Mietendeckel aktiv. Die kommunale Maßnahme sollte starken Anstieg der Mieten in der Hauptstadt bremsen. Mit dem 23. Februar 2020 waren die Mieten für 1,5 Mio. Wohnungen auf dem Stand vom Juni 2019 eingefroren. Ab 2022 hätten sie höchstens um 1,3 Prozent jährlich steigen dürfen. Doch das Bundesverfassungsgericht kippte das Landesgesetz mit der zentralen Begründung: Der Bundesgesetzgeber habe das Mietpreisrecht abschließend geregelt – für eigene Gesetze der Länder sei deshalb kein Raum ORF/Christian Öser Ein neues Wohnhaus im Stadtentwicklungsgebiet Europacity in Berlin-Mitte wurde jüngst zum Politikum: So reichte der Berliner Senat Klage gegen Unternehmen ein, die anstatt geplanter Sozialwohnungen teure Apartments vermarkten. ORF/Christian Öser In Berlin sind die Mietpreise im vierten Quartal 2024 bundesweit so stark gestiegen wie in keiner anderen deutschen Großstadt: um 8,5 Prozent im Vergeich zum Vorjahreszeitraum. Bundesweit erhöhten sich die Mietpreise um durchschnittlich 4,7 Prozent, wie aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervorgeht. ORF/Christian Öser Bei den Käufern ist die Lage anders als bei Mietern: 2024 sind zwar die Zinsen leicht gesunken, aber die Erschwinglichkeit von Wohneigentum sei noch deutlich schlechter als 2022, sagt das Institut für deutsche Wirtschaft. Dadurch zögern viele den Schritt hinaus oder sie fragen eher Mietwohnungen nach, was den Mietmarkt zusätzlich unter Druck setze. ORF/Christian Öser Das erste Hochhaus Berlins wurde 1922 im Auftrag von Degewo errichtet. Sie bewirtschaftet über 75.000 Wohnungen und 1.500 Gewerbeeinheiten in Berlin. Degewo ist die größte der sechs landeseigenen Wohnungsgesellschaften und die zweitgrößte insgesamt in der Hauptstadt. ORF/Christian Öser „Kiez statt Profitwahn – Spreeufer für alle!“ war in den 2010er Jahren jene Protestformel, die gegen die Bebauung des Spreeufers mobilmachte. Die Rufe verhallten, die Pläne zur Bebauung des Spreeufers wurden nicht gestoppt. ORF/Christian Öser Vom Verbändebündnis „Soziales Wohnen“ wurde 2019 erstmals das Ziel geäußert, dass Deutschland bis 2030 zwei Millionen Sozialwohnungen haben sollte. Laut dem Mieterbund gibt es nur noch etwa eine Million Sozialwohnungen in Deutschland – Tendenz stark rückläufig. Für den Bau zuständig sind die Länder. Der Bund bezuschusst den Bau aber zu einem großen Teil. ORF/Christian Öser Grundsätzlich können alle, die über einen „Wohnberechtigungsschein“ verfügen, eine Sozialwohnung beanspruchen. Einen Anspruch darauf hat man, wenn das Einkommen eine bestimmte Grenze nicht überschreitet. Das gilt auch für Auszubildende und Studierende. Die Einkommensgrenzen für einen Anspruch legen die Länder fest. ORF/Christian Öser Berlin gehört bezüglich Wohnen im Neubau zu den teuersten Städten in Deutschland. Laut aktuellsten Zahlen sind für einen Quadratmeter 18,18 Euro Miete zu bezahlen. Nur Frankfurt (19,17 Euro) und München (22,08 Euro) sind teurer. ORF/Christian Öser Zwei von drei Mietern würden einer Umfrage zufolge gerne Wohneigentum erwerben, scheitern dabei aber vor allem an finanziellen Hürden. Besonders stark ausgeprägt ist der Wunsch mit 82 beziehungsweise 81 Prozent in den Altersgruppen von 18 bis 29 Jahren sowie 30 bis 44 Jahren, wie aus einer neuen Forsa-Befragung hervorgeht. 48 Prozent gaben allerdings an, bisher sei der Immobilienkauf am nötigen Eigenkapital gescheitert. Bei 40 Prozent reicht das Einkommen nicht für die Kreditrate aus. 65 Prozent fordern daher mehr staatliche Hilfen zum Erwerb von Wohnungen bzw. Häusern.
Bild 1 von 12
Erst in der Vorwoche wurde diese Überschlagsrechnung mit neuen Daten belegt – und Berlin sticht im negativen Sinne heraus: Einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln zufolge wurden Mietwohnungen in Deutschland im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um durchschnittlich 4,7 Prozent teurer. Berlin liegt deutlich über diesem Schnitt und führt das Ranking mit plus 8,5 Prozent an.
„Im Grunde sind alle Konzepte ungenügend“
Dennoch: Ein Auslaufen der Mietpreisbremse Ende 2025 könnte die Lage zusätzlich verschärfen. Eine Verlängerung im Bundestag scheiterte am Zerbröseln der „Ampelkoalition“. Ohne Verlängerung gibt es kein Regulativ mehr. „Wohnungen, die jetzt schon teuer sind, würden noch einmal deutlich teurer werden“, so Michel. SPD und Grüne wollen eine Verlängerung, die Union hat sich bisher skeptisch und zurückhaltend gezeigt.
„In Grunde sind alle Konzepte ungenügend“, so Günther. „Die Parteien bleiben in ihren Programmen im Wesentlichen im Konjunktiv.“ Wirklich klare Aussagen wie bei der letzten Wahl, als die SPD 400.000 neue Wohnungen, davon 100.000 Sozialwohnungen jährlich, angekündigt hatte, gäbe es bei diesem Wahlkampf nicht mehr. „Das macht keiner, weil alle wissen, dass die SPD damit auf die Nase gefallen ist“, so Günther. Zudem fehle einfach das Geld für die Ankurbelung des Wohnungsbau ORF/Christian Öser Wohnungseigentum ist in Deutschland Mangelware – die absolute Mehrheit im Land sind Mieterinnen und Mieter
Sehr geringe Eigentumsquote
Ein gravierender Umstand ist auch, dass die Mehrheit der Deutschen in einem Mietverhältnis steht – die Eigentumsquote gehört mit unter 44 Prozent zu den geringsten in Europa. „Wohneigentum ist wichtig in Richtung Alterssicherung, wenn ich keinen ausgeprägten sozialen Mietwohnungsmarkt habe“, so Günther. 23 Mio. Mieterhaushalten stehen 1,1 Mio. Sozialwohnungen gegenüber, dabei wären weit über zehn Millionen Mieter berechtigt, in einer Sozialwohnung zu leben.
Hohe Mieten staatlich subventioniert
Für die kommenden Jahre erwarten die beiden Fachleute keine Entspannung. Günther spricht von „weiter steigenden Mieten“. Manche Investoren rechneten bereits damit, dass Haushalte künftig die Hälfte ihres Einkommens für die Miete ausgeben werden, ähnlich wie in London. Eine fatale Entwicklung. Deutschland gibt fast 20 Mrd. Euro für Wohngeld – einen Zuschuss zur Miete bzw. gegen die Belastung für Haushalte mit geringen Einkommen – aus. Michel sieht darin „eine massive Subventionierung hoher Mieten“.
Was die Parteien wollen
Die Ansätze der wahlwerbenden Parteien sind sehr unterschiedlich: Die SPD fordert eine staatliche Wohnungsgesellschaft und will die Mietpreisbremse verlängern, CDU/CSU setzen auf mehr Bau, weniger Energiestandards und Anreize, um den Wohnungskauf anzukurbeln.
Die Grünen fordern mehr sozialen Wohnungsbau, klimafreundliche Maßnahmen und stärkeren Mieterschutz. FDP und AfD lehnen Mietpreisregulierungen ab. Die Linke will staatliche Eingriffe. Mieten sollen auf Jahre eingefroren, Wohnkonzerne verstaatlicht werden. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) möchte sozialen Wohnungsbau stärken.
Christian Öser (Bild), Valentin Simettinger (Text), beide ORF.at, aus Berlin, Mario Palaschke (Lektorat), ORF.at