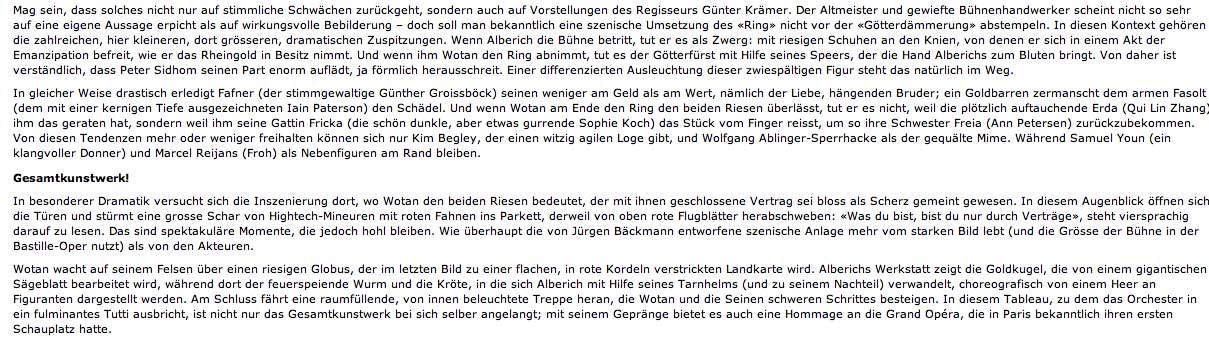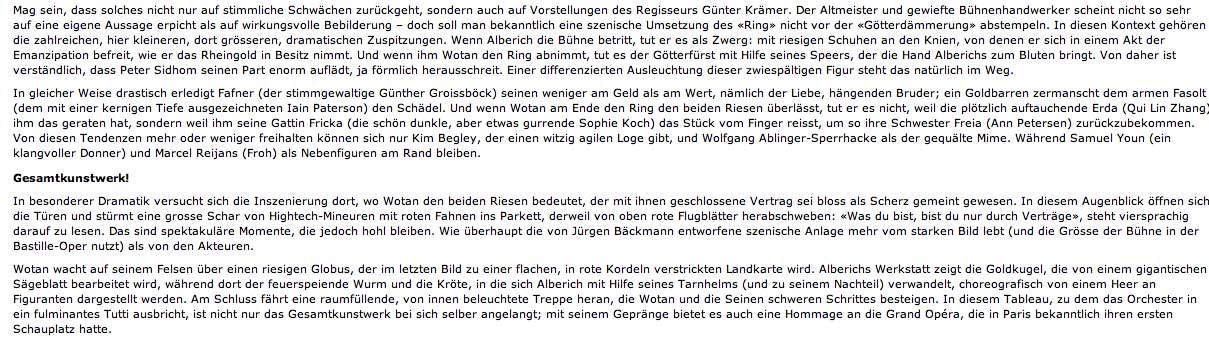Samstag, 06. März 2010, 13:14:07 Uhr, NZZ Online
Nachrichten
›
Kultur
›
Bühne und Konzert
6. März 2010, Neue Zürcher Zeitung
Wenn das Orchester erzählt
«
Rheingold» zur Eröffnung von Richard Wagners «Ring des Nibelungen» an
der Pariser Nationaloper
Das Pariser Finale - eine Hommage an die Grand Opéra von ehedem. (Bild:
Opéra National de Paris / Charles Duprat)Das erste Grossprojekt von
Nicolas Joel, dem neuen Intendanten der Pariser Nationaloper, und seines Musikdirektors
Philippe Jordan gilt Wagners «Ring». Der Auftakt mit dem «Rheingold» war
vor allem orchestral bemerkenswert.
Peter Hagmann
«
Zurück vom <Ring>», möchte man mit Richard Wagner vielleicht
einmal ausrufen. «Der Ring des Nibelungen» nimmt nicht die Spitzenwerte
von «Zauberflöte» und «Carmen» ein, das verhindern
schon die enormen Ansprüche, die mit einer Aufführung verbunden sind;
dennoch gehört die Tetralogie zu den häufig auf den Spielplan gesetzten
Werken. Und ihrer inhaltlichen Vielschichtigkeit entspricht, dass der Radius
der Interpretation inzwischen eine Weite erreicht hat, die eine Herausforderung
eigener Art darstellt. Was soll hier noch gesagt, was noch entdeckt werden?
Gesamtkunstwerk?
Für Nicolas Joel, der zu Beginn dieser Spielzeit die Leitung der Opéra
National de Paris mit ihren beiden Spielstätten an der Place de la Bastille
und im Palais Garnier übernommen hat, stellt sich diese Frage nicht. Wagemutig
steigt er gleich mit dem «Ring» ein: mit «Rheingold» und «Walküre» in
dieser Saison, mit «Siegfried» und der «Götterdämmerung» in
der nächsten. Das hat seine Logik, denn tatsächlich war der «Ring» an
der Pariser Oper seit nicht weniger als 53 Jahren abwesend. Es war Hans Knappertsbusch,
der 1957 die letzte Gesamtaufführung dirigierte, die damals verwendete
Ausstattung soll 1908 entstanden sein. Rolf Liebermann hatte es in den Goldenen
Jahren des Palais Garnier zwar versucht, doch musste das Unternehmen vorzeitig
abgebrochen werden.
Er war also überfällig, dieser «Ring». Dazu kommt nun,
dass die Pariser Oper jetzt wieder über einen Musikdirektor verfügt
(Gerard Mortier, der Vorgänger Joels, hatte diese Position nicht besetzt).
Und dass mit dem 35-jährigen Schweizer Philippe Jordan ein Dirigent ans
Haus gekommen ist, der für die Musik der deutschen Spätromantik ein
ganz besonderes Faible hat. Das hat er nicht zuletzt am Opernhaus Zürich
bewiesen, wo er mit Erfolg eine Wiederaufnahme des Wilson-«Ring» dirigiert
hat. Seinen Einstand in Paris gab er Mitte November 2009 mit, notabene, dem
Violinkonzert von György Ligeti, gespielt von Isabelle Faust, und der «Alpensinfonie» von
Richard Strauss, die jetzt bei Naïve auf CD erschienen ist. Eine Aufnahme,
die Kult werden könnte.
Da liegt denn auch der Akzent in dem neuen «Ring». Wie
Philippe Jordan das Orchester der Pariser Oper hinter dem Busch hervorlockt
und was
er aus der Partitur Wagners heraushört – das ist schlicht eine Sensation.
In Zürich kam seine Sicht wohl darum nicht so sehr ans Licht, weil das
Opernhaus für diese Musik letztlich doch zu klein ist. Die Bastille-Oper
bietet da wesentlich mehr Weite, und Jordan nutzt das glänzend. Schon
der 136 Takte lang liegende Es-Dur-Akkord, aus dessen Raunen Wagners Weltentwurf
heraufsteigt, führt vor, wie die Dynamik gespreizt und mit welcher Lust
die Farbenpracht ausgekostet werden kann. Immer wieder versinkt das Orchester
in ein murmelndes Pianissimo, die Eruptionen werden mit aller Sorgsamkeit gesteuert,
wozu auch ein vergleichsweise langsames Grundtempo beiträgt, die kontrapunktische
Machart der Partitur wird, und zwar weit über die Leitmotivik hinaus,
deutlich herausgearbeitet und genutzt. Zugleich kommen, da ein heller, aufgelichteter
Klang und eine leichte, sozusagen antiheroische Diktion herrschen, die Farben
des von Wagner eingesetzten Instrumentariums zu prächtigster Wirkung.
Wie kaum je wird damit deutlich, in welchem Mass es im Grunde das Orchester
ist, das im «Ring» die Geschichte erzählt. Pierre Boulez,
an der Premiere rüstig anwesend, hat im Bayreuther Jahrhundert-«Ring» von
1976 diesen Interpretationsansatz prononciert verfolgt, Michael Gielen und
Bernard Haitink haben ihn in den späten achtziger Jahren in je eigener
Weise weiterentwickelt, und Philippe Jordan nimmt nun den Faden auf: technisch
(bis auf die verwackelten Ambosse in Alberichs Werkstatt) absolut untadelig,
in den Einzelheiten des Ausdrucks aber in ungeahnte Bereiche der Verfeinerung
vorstossend. Doch gerät Wagners Musikdrama darob nicht zur sinfonischen
Dichtung, dazu bleibt Jordan viel zu sehr auch der geschmeidige Begleiter – dadurch
unterscheidet sich der neue Pariser «Ring» von der Gemeinschaftsproduktion
des Festivals von Aix-en-Provence und der Salzburger Osterfestspiele, bei der
die Berliner Philharmoniker mit Simon Rattle eine, wenn nicht die Hauptrolle
spielen.
Indessen ist auch in diesem jüngsten «Ring» wenig vom Text
zu verstehen, doch hat das mehr mit der Gesangstechnik, nämlich die Fokussierung
auf das Legato und den geschlossenen Bogen, und mit der schwierigen Raumakustik
in der Bastille-Oper als mit der orchestralen Präsenz zu tun. Überhaupt
herrscht, leider ganz anders als im Graben, auf der Bühne eine Neigung
zu altmodisch aufgeplustertem Wagner-Gesang. Wenn die drei Rheintöchter
ihr übles Spiel mit Alberich beginnen, fällt Nicole Piccolomini (Flosshilde)
gegenüber Caroline Stein (Woglinde) und Daniela Sindram (Wellgunde) durch
heftiges Übersteuern ab. Und Falk Struckmann als Wotan wabert, dass es
eine Art hat; der herrliche Einstieg in die Partie im zweiten Bild, da Wotan
in Dreiklangsbrechungen «Mannes Ehre» und «ewige Macht» beschwört,
verliert dadurch seine trotzige Virilität.
Mag sein, dass solches nicht nur auf stimmliche Schwächen zurückgeht,
sondern auch auf Vorstellungen des Regisseurs Günter Krämer. Der
Altmeister und gewiefte Bühnenhandwerker scheint nicht so sehr auf eine
eigene Aussage erpicht als auf wirkungsvolle Bebilderung – doch soll
man bekanntlich eine szenische Umsetzung des «Ring» nicht vor der «Götterdämmerung» abstempeln.
In diesen Kontext gehören die zahlreichen, hier kleineren, dort grösseren,
dramatischen Zuspitzungen. Wenn Alberich die Bühne betritt, tut er es
als Zwerg: mit riesigen Schuhen an den Knien, von denen er sich in einem Akt
der Emanzipation befreit, wie er das Rheingold in Besitz nimmt. Und wenn ihm
Wotan den Ring abnimmt, tut es der Götterfürst mit Hilfe seines Speers,
der die Hand Alberichs zum Bluten bringt. Von daher ist verständlich,
dass Peter Sidhom seinen Part enorm auflädt, ja förmlich herausschreit.
Einer differenzierten Ausleuchtung dieser zwiespältigen Figur steht das
natürlich im Weg.
In gleicher Weise drastisch erledigt Fafner (der stimmgewaltige Günther
Groissböck) seinen weniger am Geld als am Wert, nämlich der Liebe,
hängenden Bruder; ein Goldbarren zermanscht dem armen Fasolt (dem mit
einer kernigen Tiefe ausgezeichneten Iain Paterson) den Schädel. Und wenn
Wotan am Ende den Ring den beiden Riesen überlässt, tut er es nicht,
weil die plötzlich auftauchende Erda (Qui Lin Zhang) ihm das geraten hat,
sondern weil ihm seine Gattin Fricka (die schön dunkle, aber etwas gurrende
Sophie Koch) das Stück vom Finger reisst, um so ihre Schwester Freia (Ann
Petersen) zurückzubekommen. Von diesen Tendenzen mehr oder weniger freihalten
können sich nur Kim Begley, der einen witzig agilen Loge gibt, und Wolfgang
Ablinger-Sperrhacke als der gequälte Mime. Während Samuel Youn (ein
klangvoller Donner) und Marcel Reijans (Froh) als Nebenfiguren am Rand bleiben.
Gesamtkunstwerk!
In besonderer Dramatik versucht sich die Inszenierung dort, wo Wotan den beiden
Riesen bedeutet, der mit ihnen geschlossene Vertrag sei bloss als Scherz gemeint
gewesen. In diesem Augenblick öffnen sich die Türen und stürmt
eine grosse Schar von Hightech-Mineuren mit roten Fahnen ins Parkett, derweil
von oben rote Flugblätter herabschweben: «Was du bist, bist du nur
durch Verträge», steht viersprachig darauf zu lesen. Das sind spektakuläre
Momente, die jedoch hohl bleiben. Wie überhaupt die von Jürgen Bäckmann
entworfene szenische Anlage mehr vom starken Bild lebt (und die Grösse
der Bühne in der Bastille-Oper nutzt) als von den Akteuren.
Wotan wacht auf seinem Felsen über einen riesigen Globus, der im letzten
Bild zu einer flachen, in rote Kordeln verstrickten Landkarte wird. Alberichs
Werkstatt zeigt die Goldkugel, die von einem gigantischen Sägeblatt bearbeitet
wird, während dort der feuerspeiende Wurm und die Kröte, in die sich
Alberich mit Hilfe seines Tarnhelms (und zu seinem Nachteil) verwandelt, choreografisch
von einem Heer an Figuranten dargestellt werden. Am Schluss fährt eine
raumfüllende, von innen beleuchtete Treppe heran, die Wotan und die Seinen
schweren Schrittes besteigen. In diesem Tableau, zu dem das Orchester in ein
fulminantes Tutti ausbricht, ist nicht nur das Gesamtkunstwerk bei sich selber
angelangt; mit seinem Gepränge bietet es auch eine Hommage an die Grand
Opéra, die in Paris bekanntlich ihren ersten Schauplatz hatte.
Diesen Artikel finden Sie auf NZZ Online unter:http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/buehne/wenn_das_orchester_erzaehlt_1.5152624.html
Copyright © Neue Zürcher Zeitung AG
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung oder Wiederveröffentlichung
zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis
von NZZ Online ist nicht gestattet.