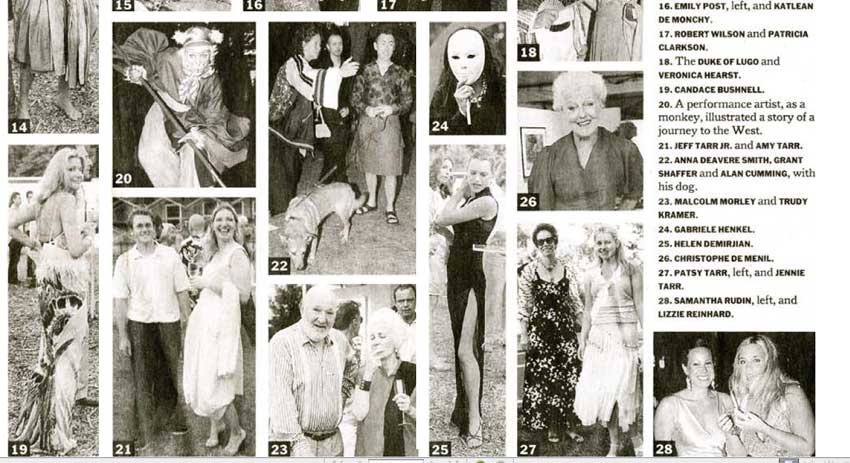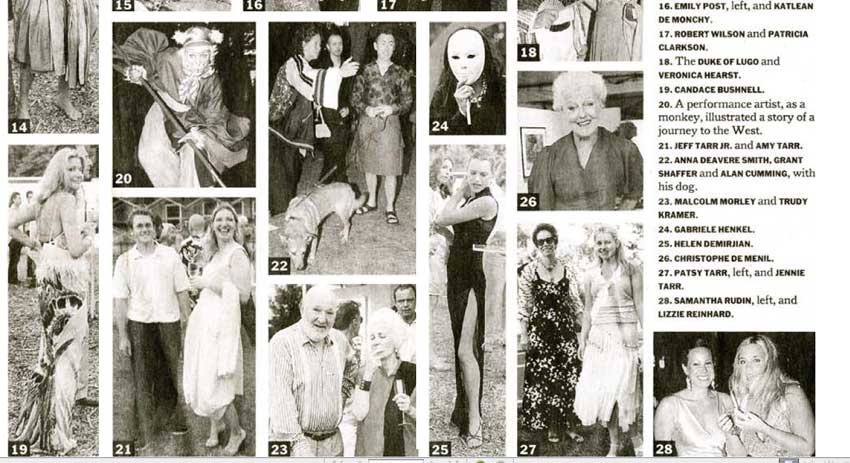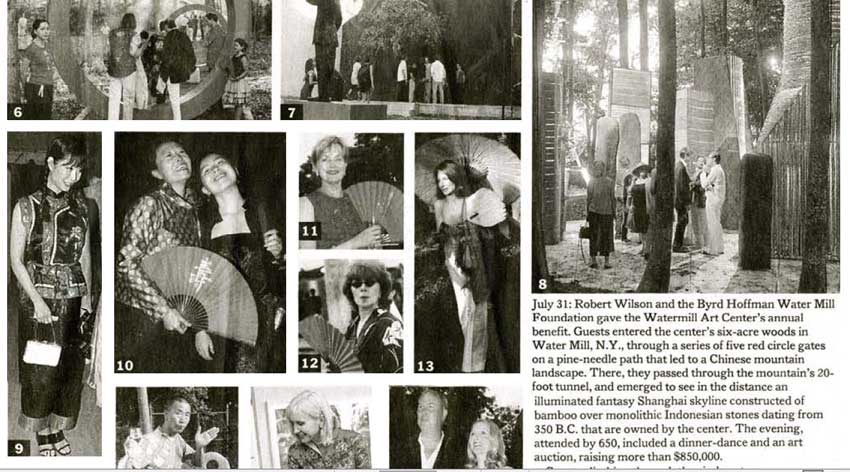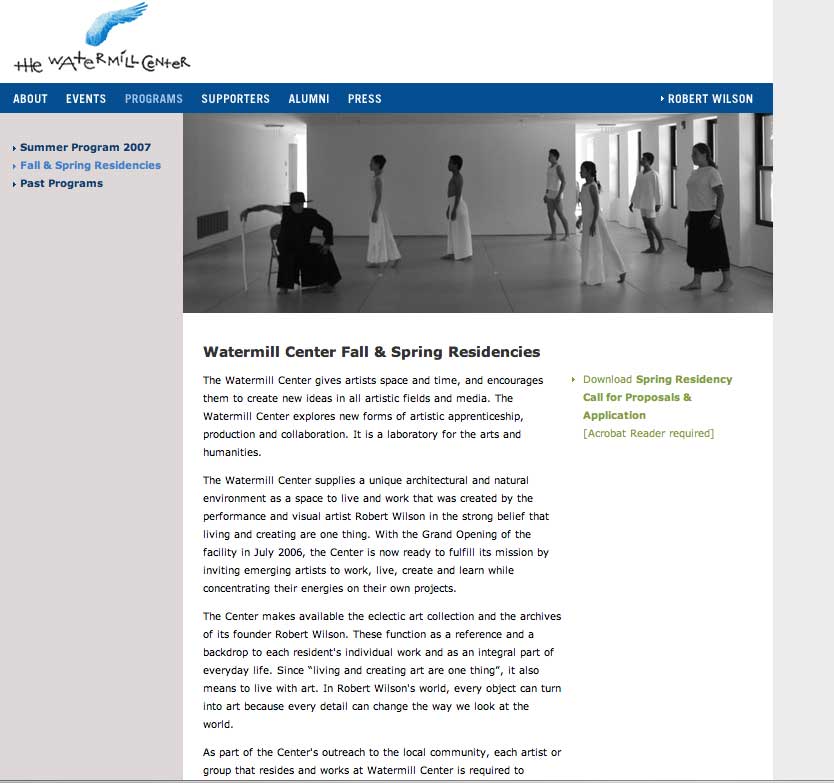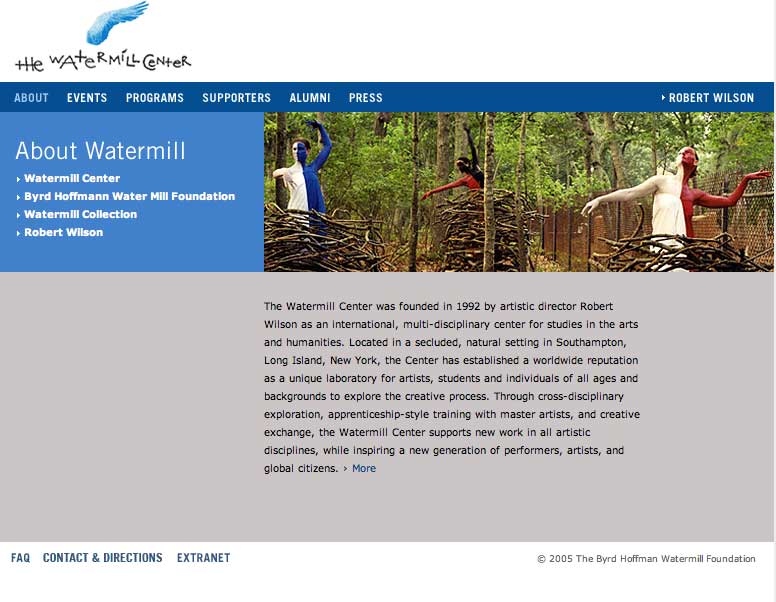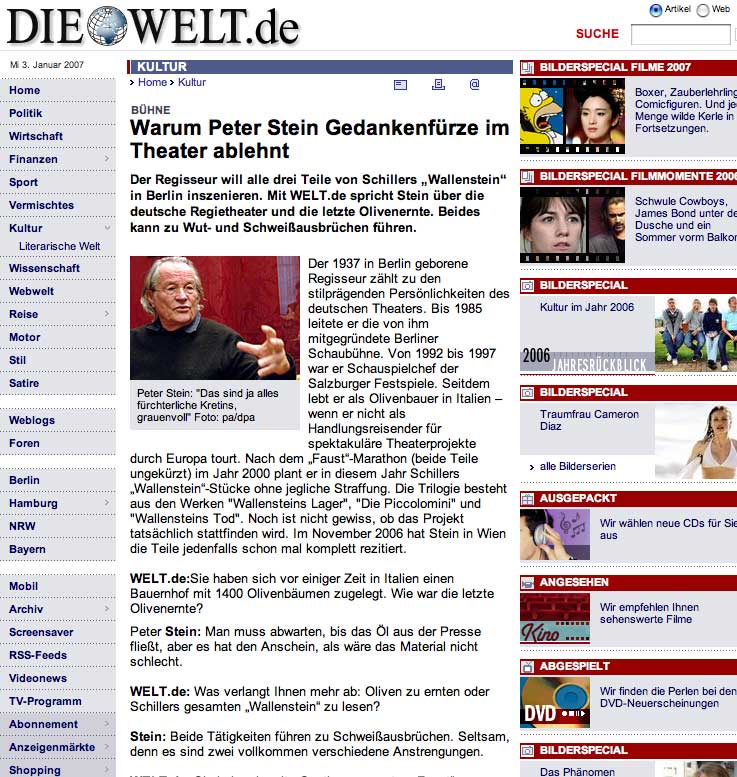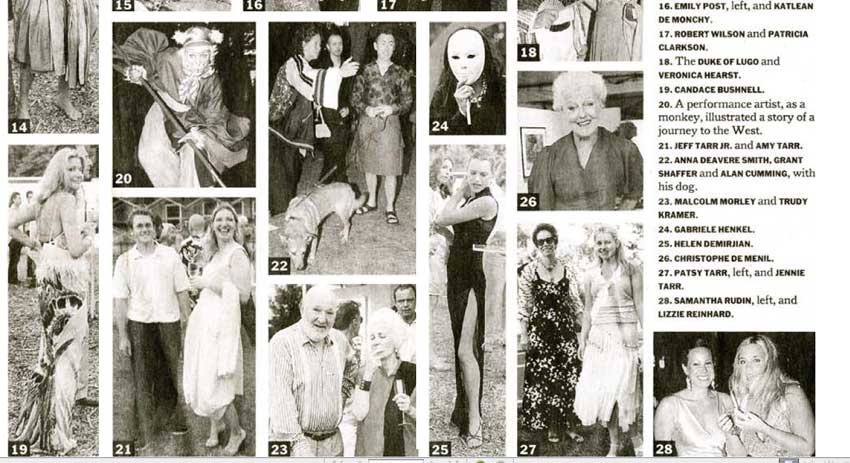
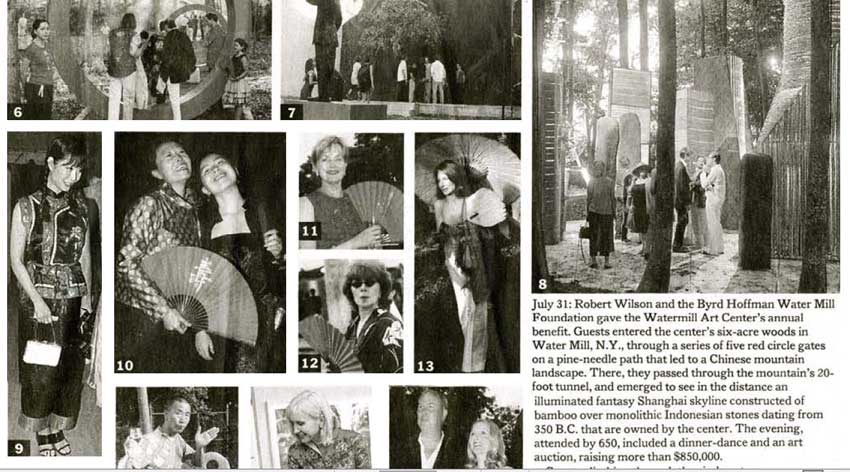
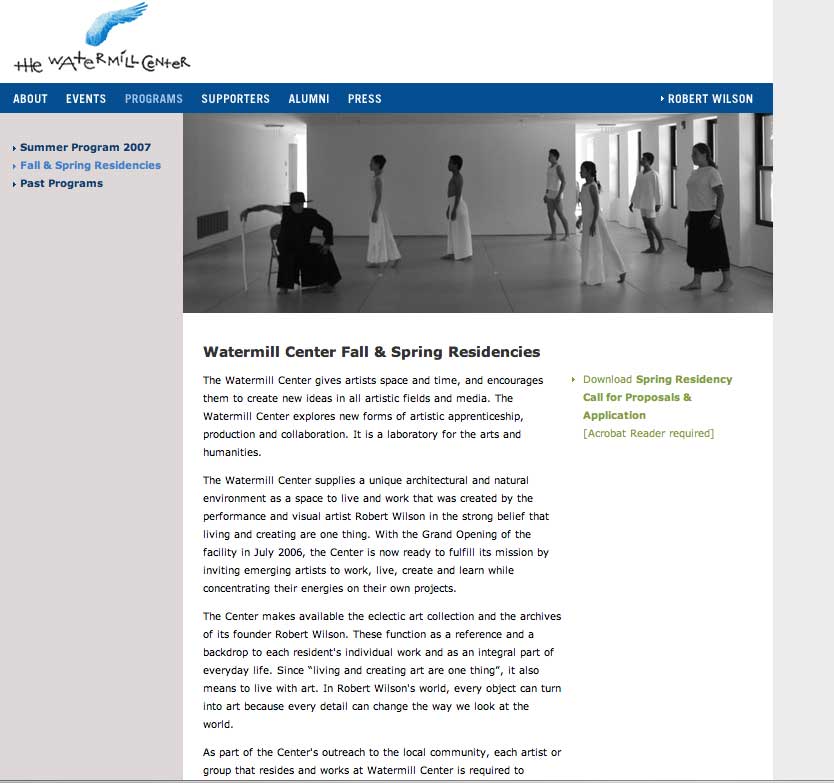
Home
Kultur
BÜHNE
Warum Peter Stein Gedankenfürze im Theater ablehnt
Der Regisseur will alle drei Teile von Schillers „Wallenstein“ in
Berlin inszenieren. Mit WELT.de spricht Stein über die deutsche Regietheater
und die letzte Olivenernte. Beides kann zu Wut- und Schweißausbrüchen
führen.
Peter Stein: "Das sind ja alles fürchterliche Kretins, grauenvoll" Foto:
pa/dpa
Der 1937 in Berlin geborene Regisseur zählt zu den stilprägenden
Persönlichkeiten des deutschen Theaters. Bis 1985 leitete er die von ihm
mitgegründete Berliner Schaubühne. Von 1992 bis 1997 war er Schauspielchef
der Salzburger Festspiele. Seitdem lebt er als Olivenbauer in Italien – wenn
er nicht als Handlungsreisender für spektakuläre Theaterprojekte
durch Europa tourt. Nach dem „Faust“-Marathon (beide Teile ungekürzt)
im Jahr 2000 plant er in diesem Jahr Schillers „Wallenstein“-Stücke
ohne jegliche Straffung. Die Trilogie besteht aus den Werken "Wallensteins
Lager", "Die Piccolomini" und "Wallensteins Tod".
Noch ist nicht gewiss, ob das Projekt tatsächlich stattfinden wird. Im
November 2006 hat Stein in Wien die Teile jedenfalls schon mal komplett rezitiert.
WELT.de:Sie haben sich vor einiger Zeit in Italien einen Bauernhof mit 1400
Olivenbäumen zugelegt. Wie war die letzte Olivenernte?
Peter Stein: Man muss abwarten, bis das Öl aus der Presse fließt,
aber es hat den Anschein, als wäre das Material nicht schlecht.
WELT.de: Was verlangt Ihnen mehr ab: Oliven zu ernten oder Schillers gesamten „Wallenstein“ zu
lesen?
Stein: Beide Tätigkeiten führen zu Schweißausbrüchen.
Seltsam, denn es sind zwei vollkommen verschiedene Anstrengungen.
WELT.de: Sie haben bereits Goethes gesamten „Faust“ an einem Stück
gespielt. Die von Ihnen bevorzugten Marathon-Distanzen werden leicht zu körperlichen
Bewährungsproben.
Stein: Ich strenge mich an, damit man das nicht merkt. Niemand, der dafür
bezahlt hat, soll das Gefühl haben, dass sich hier jemand ächzend
durchquält. Ich versuche das so leicht und fließend wie möglich
zu machen. Aber natürlich ist es am Ende doch anstrengend. Ich weiß auch
nicht, wie viele Leute am Ende beim „Wallenstein“ einschlafen werden.
WELT.de: Noch mal zurück zu Ihren Olivenbäumen. Warum dieser Rückzug
aufs Land?
Stein: Wissen Sie, alte Knacker wie ich, wenn die mal die Fünfzig erreicht
haben, sehnen sich nun einmal ganz banal nach einem Häuschen im Grünen.
Dass mir ein Bauernhof in die Hände gefallen ist, war gar nicht vorgesehen.
Jetzt habe ich 1400 Olivenbäume – und die Not, diese komischen Früchte
irgendwie runter zu holen.
WELT.de: Also kein Exil?
Stein: Einzig insofern, als ich nicht mehr in Deutschland wohne und auch beabsichtige,
dieses Land so wenig wie möglich zu betreten.
WELT.de: Und die reiche deutsche Theaterlandschaft?
Stein: Da wird so blödes Zeug veranstaltet, das mich überhaupt nicht
interessiert. Irgendwelcher Quark, irgendwelche besserwisserischen Ideechen.
Anstatt die Werke zu interpretieren. Das ist eben meine Vorstellung von Theater,
dass man Interpret eines Werks ist und sich als solcher für die Absichten
des Autors interessiert, der dieses Werk geschaffen hat.
WELT.de: Aber die Zeiten ändern sich und mit ihnen die Interpretationen.
Stein: Mittlerweile glauben die Regisseure, sie seien die eigentlichen Autoren.
Sie nutzen das Material von den wirklichen Autoren nur noch als Steinbruch.
Das kann man machen. Ich halte das für Schwachsinn und interessiere mich
nicht für die Gedankenfürze von diesen relativ dummen Leuten, die
sich zurzeit Regisseure nennen. Bekanntlich sind Theaterleute – das ist
das Entsetzliche – nicht fürchterlich intelligent. Das brauchen
sie auch gar nicht zu sein. Denn sie sollen ja lediglich die Texte von anderen
Leuten zum Leben erwecken.
WELT.de: Glauben Sie, dass solche Totalaufführungen wie Ihr „Faust“ oder
der nun geplante „Wallenstein“ im Sinne der Autoren lagen?
Stein: Natürlich! Schiller hat sich das inständig gewünscht.
Er hat verzweifelt versucht, eine Gesamtaufführung des Werkes zu ermöglichen.
Aber so etwas ist eben schwer zu leisten. Ich organisiere das nun: das Gesamtwerk,
so wie es gestaltet ist, einmal hintereinanderweg zu durchlaufen, nicht an
zwei Abenden, sondern als ein Theaterstück. Das kann man nicht in ein
Repertoire-Theater einbauen. Dazu ist es viel zu lang, schon die Arbeitszeit-Regelungen
erlauben das nicht. Da muss man extra eine Halle mieten, die muss man einrichten,
man muss für Essen sorgen, für Toiletten. Ich bilde mir ein, für
all dies das notwendige Knowhow zu haben.
WELT.de: Ist es nicht auch eine bewährte Gepflogenheit, zu kürzen?
Stein: Selbst wenn ich kürze, bleiben da immer noch zweieinhalb Stücke.
Mit Pausen ist man schnell bei neun bis zehn Stunden.
WELT.de: Steckt in solchen Ausdehnungen die Utopie, dass Real- und Kunstzeit
zusammenfallen?
Stein: Das Thema des Theaters ist grundsätzlich die Zeit. Nehmen Sie die
Aufführungen der Tragödien in Griechenland. Wie wir ziemlich genau
wissen, fingen die um neun Uhr an und hörten um sechs, sieben Uhr mit
Einbruch der Dämmerung auf – ein Theatertag, an dem sich die Zeitvorstellungen
der Leute ununterbrochen verschoben haben, mal verdichtet, mal gedehnt. Menschen,
die sich heute noch dafür interessieren, solche Erfahrungen zu machen,
biete ich das an. Dahinter steckt keine Werktreue-Ideologie, sondern schlicht
und einfach ein alternatives Angebot.
WELT.de: Das klingt sehr marktorientiert.
Stein: Absolut. Ich suche einen Markt, auf dem ich meine Produkte verkaufen
kann. Und die haben eine bestimmte Charakteristik.
WELT.de: Der Markt gehört zurzeit anderen Produktionen: Gefeiert wurde
jüngst ein „Wallenstein“ der Gruppe Rimini-Protokoll. Die
Rollen wurden darin mit echten Protagonisten besetzt – Politikern, Vietnamveteranen,
Astrologen. Schillers Text kommt auf der Bühne nur noch in Form kleiner
Reclamheftchen vor.
Stein: Ohne Schillers Text? Aha, so wird das heute also gemacht. Können
Sie mir sagen, warum ich ins Theater gehen soll? Um mir anzuschauen, wie irgendwelche
Politiker über Reclam-Texte von Herrn Schiller schreiten? Das ist doch
völliger Schwachsinn. Mich würden Sie in so etwas nie hineinbringen.
Weil ich mich gerade für die Worte interessiere, die Schiller geschrieben
hat.
WELT.de: Was haben Sie über das Stück mitzuteilen?
Stein: Beim Lesen ging es mir sehr seltsam. Was ist das für eine Struktur?
Wallenstein tritt zunächst nicht auf. Und wenn er aufgetreten ist, dann
passiert nichts. Alles wird immer nur hinausgeschoben, jedes Geschehen, jede
Handlung, jede Tätigkeit, es wird geredet, gezweifelt, gezögert.
Dann ging mir auf, dass genau diese Schwierigkeit, einen Entschluss zu fassen,
Gegenstand des Stücks ist. Der Mensch ist frei: Er kann sich so oder anders
entscheiden. Aber wie er sich auch entscheidet, es wird schlecht ausgehen.
Denn genau jene Hybris, sich als entscheidungsberechtigt zu setzen ist es,
die die Götter strafen. Das ist die Mitteilung der Tragödie.
WELT.de: Wie weit sind die Vorbereitungen zu der Inszenierung am Berliner Ensemble
denn gediehen? Wie man hört, soll Brandauer Ihr Hauptdarsteller werden,
nachdem der ursprünglich favorisierte Gert Voss Ihnen einen Korb gegeben
hat?
Stein: Wie das genau war, wissen weder Sie noch ich. Auf jeden Fall hat mir
der Voss in der Tat erst zugesagt, dann abgesagt. Vielleicht aus Bequemlichkeit.
Oder er hat gehofft, das mit Andrea Breth am Burgtheater machen zu können.
Nun hört man, dass die das in Wien nicht auf die Beine kriegen, es gibt
sogar Leute, die sagen, das sei im Grunde genommen schon längst abgesetzt.
Ich persönlich finde das sehr bedauerlich. Was meine Inszenierung angeht,
so ist noch nichts entschieden. Es gibt finanzielle und juristische Probleme.
Wir arbeiten daran. Wenn das nicht bald durch ist, schmeiß ich’s
hin.
WELT.de: „Wär’s möglich, könnt ich nicht mehr wie
ich wollte?“, sagt Wallenstein. Haben Sie sich das auch schon einmal
gefragt?
Stein: Dass ich als alter Knacker abzutreten habe, ist doch vollkommen normal;
da bin ich heilfroh. Das ist ganz in Ordnung, ich will mit dem ganzen Kram
nichts mehr zu tun haben. Auch mit diesem widerwärtigen Kritikerwesen
in Deutschland, das sind ja alles fürchterliche Kretins, grauenvoll. Darunter
habe ich früher einmal gelitten, jetzt leide ich nicht mehr, das ist doch
ein Fortschritt.
WELT.de: Mittlerweile stoßen sich viele Kritiker an denselben Theaterformen
wie Sie.
Stein: Das ist ja das besonders Lächerliche. Leute wie dieser Herr Stadelheimer – oder
wie der heißt – haben sich einmal hervorgetan in der Abschaffung
des sogenannten alten Theaters, haben mich als Idioten beschimpft. Und nun
beklagen sie plötzlich, dass das, was sie hervorgebracht haben, so saudoof
sei. Das ist wirklich peinlich.
WELT.de: Würde es Sie angesichts ihrer ökonomischen und organisatorischen
Kompetenz nicht reizen, einmal wieder in ein Theater einzutreten?
Stein: Nein. Ich bin nie in ein Theater eingetreten. Ich habe immer nur Theater
gegründet. Auch als ich an das Festival von Salzburg gegangen bin, habe
ich das völlig neu gegründet. Ich bin kein Nachfolger.
Das Gespräch führte Stefan Kister
Artikel erschienen am 02.01.2007
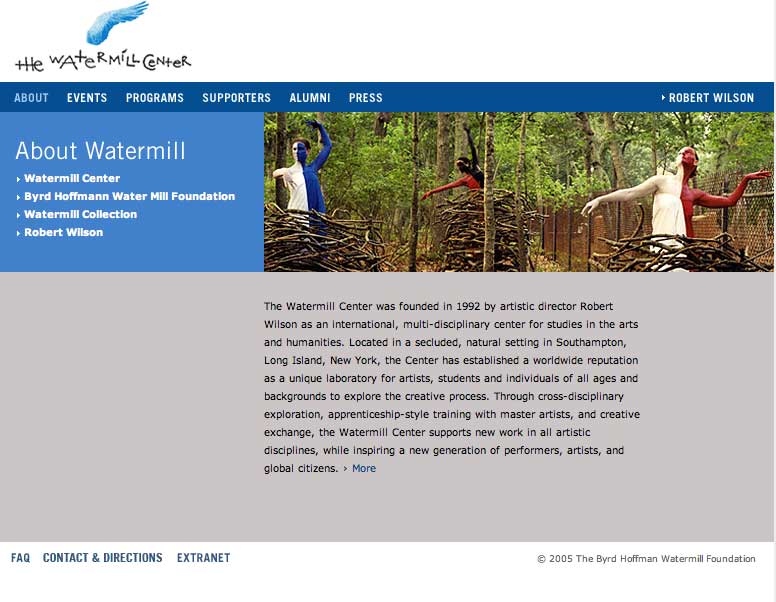
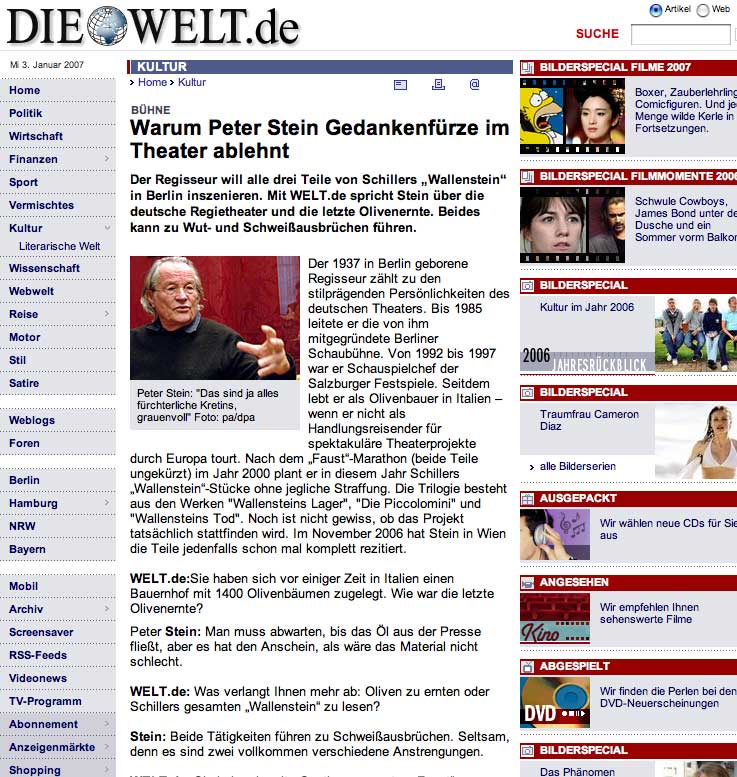
Donnerstag, den 4.Januar 2007
zwei Theaterleute mit Leben auf dem Land
Aber
siehe auch>