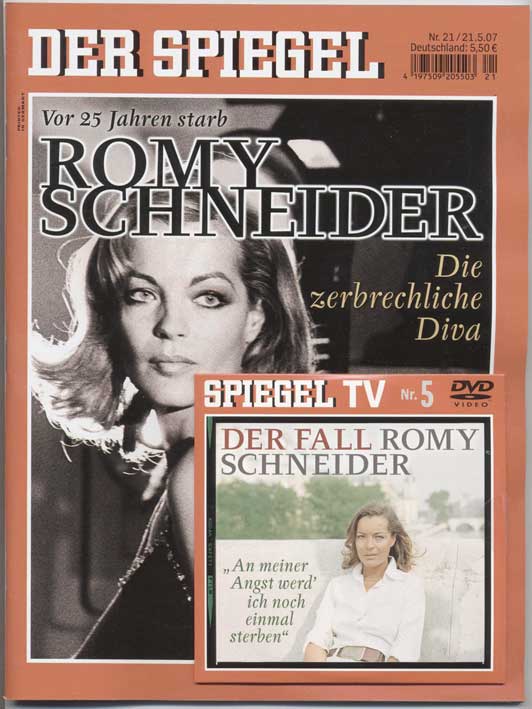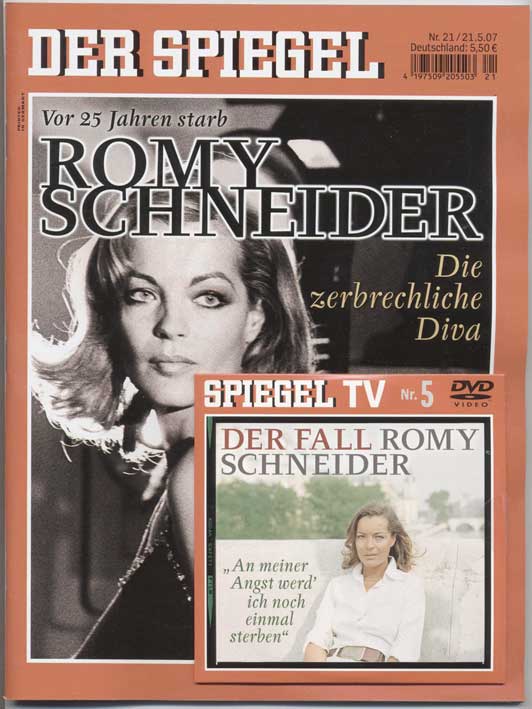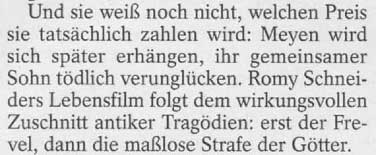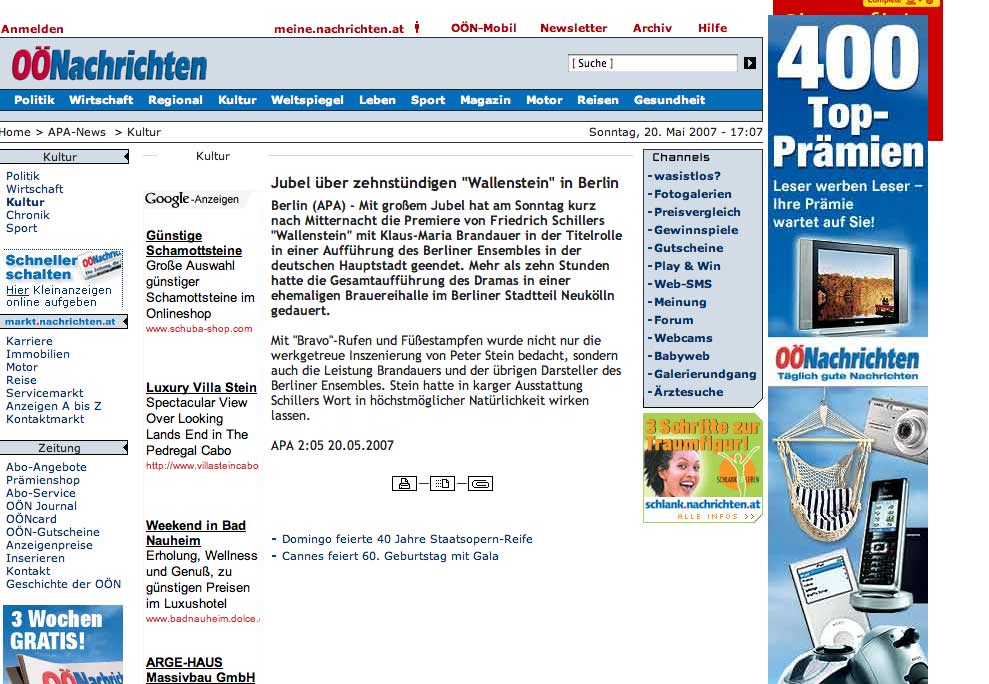SPIEGEL
ONLINE - 20. Mai 2007, 17:10
URL: http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,483762,00.html
"
WALLENSTEIN"-MARATHON
Einfahrt in den Schiller-Bunker
Von Jenny Hoch
In seinem neuesten Mammutprojekt erweist sich Peter Stein einmal mehr als demütiger
Textarbeiter: Geschlagene zehn Stunden dauert seine Berliner Inszenierung von
Schillers "Wallenstein". Ohne den Wortakrobaten Brandauer hätte
das Unternehmen mit einer Bruchlandung geendet.
In Berlin hat soeben ein neues, ziemlich ungewöhnliches Museum aufgemacht.
Es befindet sich darin nur eine einzige Vitrine. Sie hat die Form eines enormen
rechteckigen Guckkastens, und man kann dort echte Menschen in historischen
Kostümen und Zottelperücken dabei beobachten, wie sie historische
Vorfälle nachstellen, die schon zu der Zeit, als ein berühmter Dramatiker
sie aufschrieb, ein alter Hut waren: Heerscharen von Schauspielern spielen
den Niedergang des berühmten Feldherrn Wallenstein im Dreißigjährigen
Krieg nach, dem Friedrich Schiller 1799 mit einem dreiteiligen dramatischen
Gedicht ein literarisches Denkmal setzte.
"
Wallenstein": Woodstock oder Weihnachtsmärchen?
Fotostrecke starten: Klicken Sie auf ein Bild (6 Bilder)
Der Direktor dieses Museums, das manche wohl auch Theater nennen würden,
ist Peter Stein, die lebende Ikone des deutschen Regietheaters. Der Mitbegründer
der Berliner Schaubühne hat sich nach seinen inzwischen nun auch schon
historisch zu nennenden Erfolgen in den sechziger und siebziger Jahren auf
eine ganz spezielle Form der Geschichts- und Dramenvermittlung verlegt: Als
demütiger Textarbeiter bringt er große Werke der Dramenliteratur
beinahe ungestrichen und ohne eigenen interpretatorischen Ansatz auf die Bühne.
Vornehmlich handelt es sich um Mammutprojekte, die er feldherrengleich organisiert
und finanziert.
Nach seiner 21-Stündigen "Faust"-Inszenierung in Expo-Jahr hatte
nun also ein 10-stündiger "Wallenstein" in der gigantischen
Kühlhalle einer aufgelassenen Brauerei im Berliner Problembezirk Neukölln
Premiere. Schon im Vorfeld hatte sein Hauptdarsteller Klaus Maria Brandauer
im SPIEGEL selbstbewusst prophezeit: "Das wird ein Schiller-Woodstock
in diesem Sommer in Berlin. Die Leute werden hinpilgern!" Und tatsächlich:
Frenetischer Applaus am Ende dieses Theater-Exerzitiums, das Schauspieler und
Zuschauer gemeinsam unter nicht unerheblichen körperlichen und physischen
Qualen durchgestanden haben. Eine Schicksalsgemeinschaft feiert sich selbst.
Soldatenfolklore und Musikantenstadl-Kitsch
Schon zu Beginn steckt Walter Schmidinger, der mit effektvollem Tremolo in
der Stimme den Prolog vom Blatt liest, das Terrain ab: es geht hier um die
ganz alte Schule der Mimenkunst - Modernisierung, Aktualitätsbezug, Entrümpelung
unerwünscht.
Was folgt, gibt zu schlimmsten Befürchtungen Anlass: "Wallensteins
Lager" sieht aus, als habe man die Karl-May-Festspiele in den Winter verlegt:
Durch knöcheltiefen Kunstschnee stapfen pittoresk gekleidete Soldaten
(Kostüme: Moidele Bickel). Man zecht unter Tipi-artigen Zeltplanen, und
wer etwas zu sagen hat, tritt heraus und nimmt um einen hölzernen Picknick-Tisch
Platz. Selbst vor allerliebst sich balgende Kinderscharen ist Stein nicht zurückgeschreckt.
Großes Schauspielertheater sieht anders aus, das hier ist Soldatenfolklore
und Musikantenstadl-Kitsch auf Weihnachtsmärchen-Niveau.
Dann, nach mehr als zwei Stunden, Auftritt Wallenstein. Auf der inzwischen
wohltuend aufgeräumten Bühne von Ferdinand Wögerbauer trifft
der Feldherr mit seiner Gattin und seiner Tochter Thekla zusammen, die er seit
Jahren nicht mehr gesehen hat. Brandauer spielt ihn nicht unbedingt als Sympathie-Träger.
Herrisch-entschlossen und gewohnt zu befehlen, geht er auch mit seinen Familienmitgliedern
wenig zimperlich um. Da gibt es keinen Zweifel: Dieser Mann ist ein Macher,
der weiß, was er will und der sich bei seinen kriegerischen Unternehmungen
oft genug die Hände hat schmutzig machen müssen. Doch hat dieser
Wallenstein auch seine Schwachpunkte.
Wallenstein in der Sackgasse
Obwohl durch und durch Stratege, vertraut er auf die Astrologie und glaubt
an das Schicksal - ein Umstand, der ihm später zum Verhängnis werden
wird. Auch bringt ein zartes Geschöpf wie seine Tochter oder die Attraktivität
seiner Schwägerin, der Gräfin Terzky, die Elisabeth Rath grandios
als berechnende, sich ihrer Ausstrahlung bewusste Strippenzieherin darstellt,
durchaus eine weichere Saite in ihm zum Klingen. Diese schwer zu fassende Ambivalenz
der Figur weiß Brandauer überzeugend darzustellen. Sein Spiel ist
facettenreich und trotzdem nicht beliebig, auch wenn ihm der "Wallenstein" als
Material offenbar nicht ausreichte. Er mischt seiner Figur zusätzlich
noch eine Prise hamletsches Zögern und ein Schuss faustsches Streben bei.
Tatsächlich erweist sich der österreichische Großschauspieler,
der sich zuletzt eher wenig inspirierend als Regisseur versuchte, als hervorragende
Besetzung für die Mammut-Rolle. Wenn er auftritt, nimmt er die riesige
Bühne voll und ganz in Beschlag. Seine Präsenz, besonders in den
intensiven Szenen, in denen Wallenstein sich mehr und mehr in eine Sackgasse
manövriert, ist enorm. Ebenso wie seine Fähigkeit, mit seiner Stimme
zu spielen, die Schillerschen Verse zu modulieren und deren Bedeutung zu transportieren,
anstatt die Worte nur vor sich herzutragen, wie es an diesem Abend leider allzu
oft zu beobachten ist.
Reanimation statt Innovation
Mit jungen Menschen etwa, kann Peter Stein erkennbar wenig anfangen. So geraten
die Liebesszenen zwischen Max Piccolomini und Thekla zum Gefühlsdebakel.
Friederike Becht darf als Wallensteins Tochter zwar anfangs kokett sein und
mit klarer Stimme ein schönes Lied singen, doch später ist sie nur
noch hold und harmlos. Alexander Fehling verschwindet als der junge Piccolomini
förmlich unter seiner frisch ondulierten Lockenperücke und findet
zu keiner erkennbaren Haltung. Zu dieser uninspirierten Regie passt, was Stein
vorab in einem Interview kundgetan hatte: Junge Leute seien zwar nicht interessanter,
dafür sähen sie "einfach besser aus als Alte".
Bleiben die Leutnants, Generäle, Oberste und Feldmarschalls. Peter Fitz
als Octavio Piccolomini, Daniel Friedrich als Graf Terzky, Rainer Philippi
als Illo, Uli Pleßmann als Isolani und Jürgen Holtz als Buttler
halten sich wacker in der sich erbarmungslos in Richtung Untergang abspulenden
Dramaturgie Schillers. Stein versteht es, seine Einfahrt in den Schiller-Bunker
dicht und zwingend zu choreografieren und den Bühnenraum intelligent zu
nutzen. Doch das sollte eigentlich zum Handwerk eines jeden guten Regisseurs
gehören. Schauspieler lobt man ja auch nicht dafür, dass sie sich
so viel Text merken können, sondern dafür, dass sie es schaffen,
der Figur etwas Eigenes mitzugeben.
Wenn am Broadway in New York eine Neuinszenierung eines alten Stückes
herauskommt, spricht man von einem "Revival", einer Wiederbelebung.
Es geht also von vorne herein gar nicht darum, etwas Neues, künstlerisch
Eigenständiges zu erschaffen. Nichts anderes als so eine Reanimation ist
letztlich auch dieser "Wallenstein". Dem Publikum scheint das zu
gefallen, denn es wird nicht überrumpelt oder mit unangenehmen Analogien
zur heutigen Zeit oder zum eigenen Leben konfrontiert. Alles ist erwartbar
und hübsch geordnet.
Doch im Jahr 2007 darfs schon etwas mehr sein, denn schon Schiller wusste: "Eng
ist die Welt und das Gehirn ist weit".
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH
Und
am Ende sie selber tot. Damit der Film ihres Lebens wieder lebe: als Abbild
ihres Lebens. Des wahren Lebens Preis? Aber wer die Kunst einen Menschen
so darzustellen vernichtet, ist der Götter liebstes Opfer.
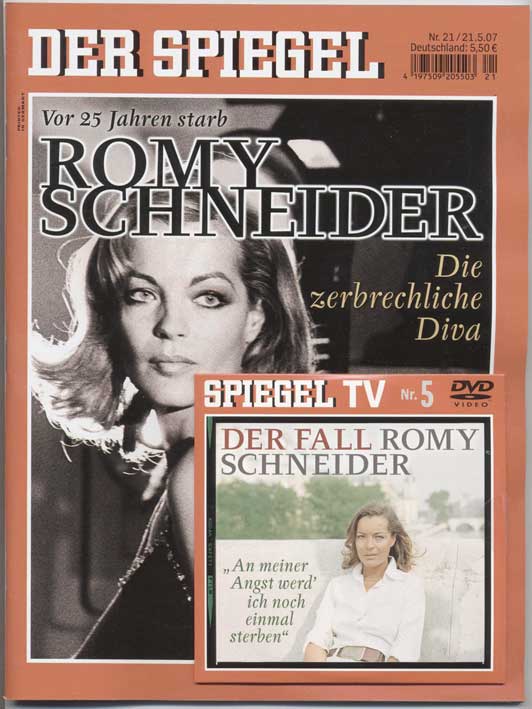





So einfach war das eben nicht.
Der, der diesen "Lebensfilm" damals machte, war eben nicht Redakteur
des BR, sondern die Leute des BR (inklusive Intendant Ö.) schnitten
und fügten hinzu, gegen seinen Willen, auf Drängen Romys,dh. H
Meyens. Und der, der den Film machte, am Anfang seines Weges, danach selbst
Produzent
aller
seiner
Filme zu
werden, damit sowas nicht mehr vorkommt, riskierte seine Zukunft,
indem man ihm Hausverbot im Haussender BR erteilte -15 Jahre, bis zum Parsifal-
und er wurde bedroht alle anderen Sender durch interne Information von
jeglicher Unterstützung
auszuschalten für alle seine Filme bei Produktion und Ankauf auf alle Zeiten.
( Berufsverbot, nach den DDR-Erfahrungen).
Die Schneereste wurden
nicht einfach rausgeschmissen und am Ende Romy mit Sohn des Kunstvernichters
ihres wahren Lebens angefügt. Dahinter liegen Kämpfe
um alles oder nichts. Nicht nur dessen, der dagegen kämpfte, um das
Bild der Porträtierten. Und die Urfassung tauchte nicht wieder
auf, sondern wurde nach über
30 Jahren wiederentdeckt , aufbewahrt von mutigen Leuten im Haus und mit
viel Mut gegen alle Regeln von Gerichtsurteilen wieder gesendet. Die
die Ehres dieses Senders aus der Hand von Interessenten- der Produzent H.
bekam einen Vertrag über 10 weitere Filme mitzumachen- retteten.

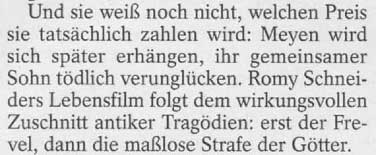
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der Motekat-Schüler P.Stein
hatte Premiere in Berlin.
Erste Nachrichten vom Abend darauf.
Ein erschöpftes, aber doch animiertes und zeitweise auch gebanntes Publikum
belohnte den Kraftakt vom Samstag bis in der Nacht zum Sonntag mit viel Applaus,
vor allem für das Darstellerensemble mit «Wallenstein» Klaus
Maria Brandauer an der Spitze, und dem grandiosen, mit Szenenbeifall bedachten
Jürgen Holtz als General Buttler. Anerkennenden, wenn auch nicht übermäßigen
Beifall gab es für Stein, der als Mitbegründer der Berliner Schaubühne
am Halleschen Ufer (und späteren Lehniner Platz) vor allem in den 1970er
Jahren in der Bundesrepublik Theatergeschichte geschrieben hat. Er wird am
1. Oktober 70 Jahre alt.
Zu den anderen Darstellern gehörten Elisabeth Rath als Gräfin Terzky,
Peter Fitz, Friedericke Becht und Elke Petri. Den Prolog mit der Schlusszeile «Ernst
ist das Leben, heiter ist die Kunst» sprach ein großer alter Mann
des deutschsprachigen Theaters, der 74-jährige Walter Schmidinger.
Die Neugier der 1200 Zuschauer, darunter Altbundespräsident Richard von
Weizsäcker, Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse, der Schweizer
Schriftsteller Adolf Muschg und der Regisseur Claus Peymann, konzentrierte
sich auf den 63-jährigen Brandauer, der im Sommer vergangenen Jahres in
Berlin die «Dreigroschenoper» inszeniert hatte. Brandauers Wallenstein
mit schulterlanger Lockenmähne, ganz in Schwarz gekleidet mit langem Ledermantel
und Stulpenstiefeln (in der schweren Rüstung wird es später etwas
eng für ihn mit der geschwellten Brust), hat starke, bewegende Momente
- dazu gehört auch ein Kuss für den geliebten Max Piccolomini («Ich
habe viele Tausend reich gemacht, dich habe ich geliebt.»).
Brandauer ist mal der geduckte Tiger, der zum Sprung ansetzt oder mit sich überschlagender
Stimme über Treue und Verrat räsoniert. Dann ist er wieder der große
Melancholiker, dem das Schicksal übel mitspielt, obwohl er sich doch selbst
so gerne als den großen Spieler sieht. Und er ist der, der am Ende Opfer
seiner eigenen Selbstüberschätzung wird, kaltblütig gemeuchelt
und blutüberströmt als der einstige Liebling der Soldaten und mächtige
Generalissimus von zwei Soldatenknechten über die Bühne geschleift.
Nach dem verschneiten Feldlager zu Beginn lässt Stein später vor
leeren Bühnenhintergrund mit verschachtelten, in unterschiedlich grellen
Farben leuchtenden Wänden spielen, die die Schauspieler besonders ins
Licht rücken. Das Problem des Stückes bestehe in seinen Dimensionen
und seiner Länge, habe schon Schiller selbst erkannt und auch eine gekürzte
Fassung erarbeitet, betont Stein im Programmheft. Der Regisseur interpretiert
dort viel in Schillers Drama hinein, so die Tragik der Unentschlossenheit in
entscheidenden Momenten des Lebens, über Liebe, Treue und Verrat - «alle
widersprüchlichen Empfindungen zu unserer Existenz spiegeln sich in diesem
Stück wider».
Das herauszufinden, muss der Zuschauer aber «Sitzfleisch» haben.
Und viel «Regietheater», wie es Stein in den wilden Aufbruchzeiten
des Theaters der 1970er Jahre mitbegründet hat, ist auch nicht zu erkennen.
Aber der (fast) «ganze Schiller» ist es allemal, mit zum Teil großen
Darsteller-Leistungen - zu hören und zu sehen an jedem Wochenende in Berlin-Neukölln
bis zum 7. Oktober.
1966
aufgen. in dem Film, als Porträt eines Gesichts bestellt. Wie sehr
dieser Film dann zu dem ihren wurde, macht die Geschichte dieses Films erst
wahr. Mit allen Änderungsversuchen
des Lebens, das sich seinen Weg auf ihre Weise erfüllte.
x
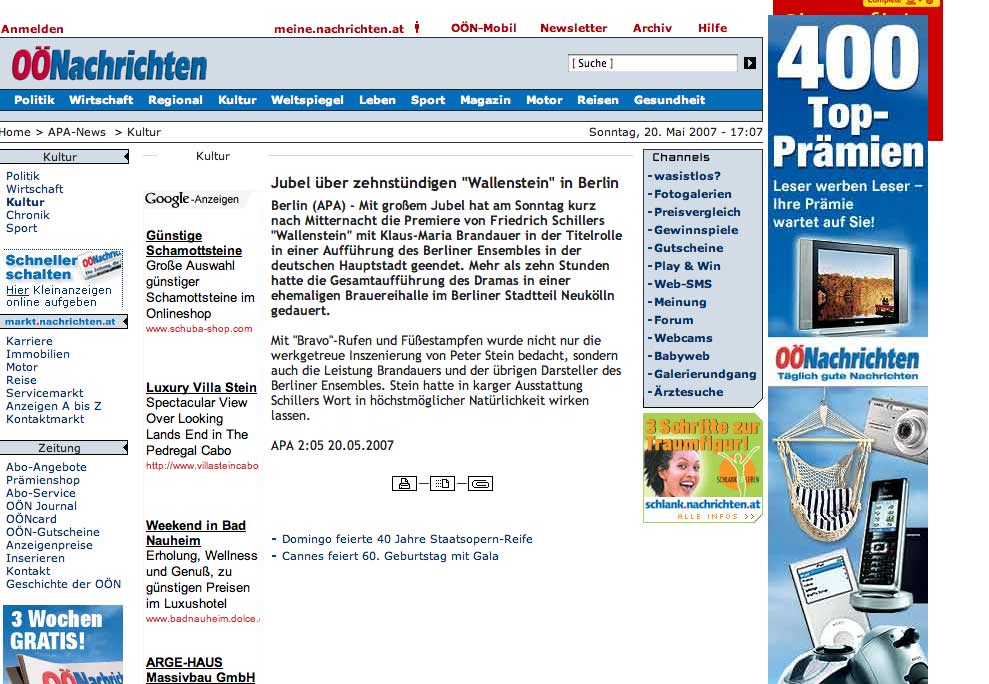
Selten
wird mit solcher Härte zugeschlagen. Der Mann tot, der alles verursachte,
der Sohn tot, der daraus entstand, sie selbst tot, die es zuliess. Was sonst
täglich überall
ungestraft geschieht, hier wurde es zum Gesetz.
Wer
die
selbstgestellten Regeln seines Abbildes -sich der Wahrheitssuche von 3 Tagen
Möglichkeiten des Ganzen, ungeschminkt und unverfläscht zu stellen-
verletzt, kommt darin um. Und alle besonder Nähe und Art, die daran partizipieren,
mit. Vielfach geschieht Übertretung täglich, diese sensible Tragödin
der Weltdarstellungen aber,
stand unter besonderem Gesetz. Durch Nähe ohne Netz. Wie sie es auf dem
Theater suchte.
So
wurde Oskar Werner als Symbol des überholten Theaters damals zu Fall gebracht.
Die Schaubühne
stieg als Gegenmodell der Moderne auf. Der Schwanengesang O.W.s im Hamlet
vor seinem Tode war in seiner Melancholie ohne Gleichen. Der Hohn tödlich.
Peymann, der heutige Retter, flog
damals raus. Misstrauensvotum anlässlich
Handke(Ritt über den Bodensee)usw.